Der Lebenszyklus lässt sich in 6
Phasen unterteilen:
|
Solitäre
Phase:
Erwachen, Staatengündung
|
Solitäre Phase:
Abflug aus dem Winterversteck,
Nahrungssuche,
Staatengründung |
Begriffsbestimmung:
Solitär
[aus französisch "solitaire" =
Einzelgänger]
Nach dem Erwachen aus der Diapause befindet
die Königin der staatenbildenden, sozialen
Faltenwespen, in der solitären Phase.
Sie lebt für eine Dauer von gut 6 Wochen
alleine (einzeln) und wird in dieser Zeit den Grundstein
für den zukünftigen Wespensaat legen.
|
|
|
Erwachen
- Aktivierungs- oder Aufwachphase (Übergangszeit
zwischen Überwinterungsphase und solitärer Phase):
Hervorgerufen durch länger werdende
Tage und steigenden Außentemperaturen im Frühjahr, wird der
Aktivierungsprozess im Organismus der Wespenkönigin in Gang
gesetzt und bewirkt das langsame Erwachen aus der totenähnlichen
Kältestarre.
Hierbei beginnt das so genannte - Endokrine System -, den
Wespenkörper langsam wieder zu beleben.
Das endokrine
System ermöglicht die Kommunikation zwischen Zellen und
Organen und ist ein System aus speziellen Geweben und
Zellgruppen.
Mit Hilfe von
Hormonen steuert das endokrine System komplexe Körperfunktionen
wie Anpassung an die Umwelt und die Reaktion auf Belastung und
Stress.
Es setzt den "erstarrten
und totenähnlichen" Wespenorganismus wieder in Gang.
Dieser Vorgang verläuft über mehrere
Tage und sogar Wochen.
Er ist deshalb so lange gesteuert,
weil es im zeitigen Frühjahr öfter mal schwankende Klimaperioden
gibt. So ist es nicht selten, dass nach ein paar warmen Tagen
wieder längere Frostperioden folgen. Folgenschwer würde ein
schnelles Verlassen des Ruheplatzes oftmals den Kältetod der
Königin bedeuten.
Der Organismus der Wespe kann
während des Erwachens auch schnell wieder auf "Sparflamme"
umschalten, befindet sich aber weiterhin in der Aktivierungs-
oder Aufwachphase.
|
Erst wenn das Klima im Frühjahr stabiler wird
und die Tagestemperaturen, für etwa 10 - 14 Tage, um die 15 Grad
Celsius liegen, führt dies zur Beendigung der Diapause.
Stoffwechsel- und auch hormonelle Funktionen der Zellen setzen
wieder ein, die Atmung steigt an und die Wespenkönigin erwacht
nun endgültig aus der Winterstarre.
Träge verlässt sie ihr winterliches Versteck. Bewegungen der Gelenkmuskulatur, durch intensives Putzen und das Testen der Flügel über die Flugmuskulatur bringen den Körper
langsam wieder in Fahrt.
Wenn die Wespenkönigin ihren Winterruheplatz
verlässt und davonfliegt, ist sie erst einmal völlig auf sich
alleine gestellt - solitäre Phase ...
Staatengründung:
Zuerst einmal gilt es
dem Körper, nach sechs Monaten Überwinterung, notwendige Energie zuzuführen.
So
sucht sich die Wespenkönigin kohlehydrathaltige Nahrungsquellen.
Hauptsächlich ist das Blütennektar. Willkommen sind aber auch
kohlehydrathaltige Baum und Pflanzensäfte. Hierbei werden u. a.
auch die aufbrechenden Blattknospen an Bäumen und Gehölzen
abgeflogen. Die aufbrechenden Blattknospen sondern einen
klebrigen, zuckrigen Safttropfen ab, der von der
Wespenkönigin gierig, als reichhaltiger Energiespender,
aufgeleckt wird.
Nach ein paar Tagen
der Nahrungsaufnahme geht die Wespenkönigin auf Nistplatzsuche und beginnt an
einem, von ihr ausgesuchten und als geeignet befundenen Ort, mit der Gründung des
zukünftigen
Wespenstaates.
|
Eine Ausnahme in ihrer Staatengründung
bilden die Feldwespen:
Nach der Überwinterung mit mehreren
Königinnen, in der s.g. "Überwinterungstraube", gründen
Feldwespen ihren Staat oftmals zusammen mit mehreren Königinnen.
Sehr oft geschieht die Nestgründung
in der Nähe des alten Neststandortes vom Vorjahr. Feldwespen
sind somit recht standorttreu.
Auch erscheinen Feldwespen bereits
recht zeitig im Frühjahr. Je nach Witterung kann das sogar schon
Anfang März sein.
In Machtkämpfen untereinander wird
festgelegt, wer die "Herrscherin" ist und das Privileg
besitzt, Eier legen zu dürfen.
Bis allerdings die ersten
Arbeiterinnen erscheinen, kann sich diese Vormacht
untereinander, in weiteren Machtkämpfen, immer wieder einmal
ändern,
Die Staatengründung von Feldwespen
beginnt somit oftmals bereits in der Kooperativen Phase
- sofern nicht eine Königin allein ihr
kleines Nest gründet und aufbaut.
|
|
|
|
Erwachen und
der Abflug in eine ungewisse Zukunft ... |
|
|
|
|
 |
Frühjahr, seit mehreren
Tagen schönes und trockenes Wetter.
Temperaturen um die 15
Grad locken nun viele Insekten aus ihren Winterverstecken.
Diese seltenen Aufnahmen
zeigen eine Königin der Roten Wespe (Vespula rufa),
beim Verlassen ihrer Winterruhestätte.
Noch recht klamm und
unbeweglich läst sich die Wespenkönigin von der Sonne
aufwärmen.
Zum Abflug erklimmt sie
einen vertrockneten Grashalm.
Oben am Halm angekommen
aktiviert die Königin ihre Flugmuskulatur und flattert mit
den Flügeln.
Wenige Sekunden später
fliegt sie noch etwas unsicher und träge, mit einem tiefen
Brummton davon. |
 |
 |
Die Aufnahmen entstanden am 30. März 2008, um 12:10 Uhr,
am Froschgrundsee in
Rödental / Oberfranken, sonniges Wetter, bei ca. 13 °C.
Wolfgang Hoffmann
© 2008 |
|
Frühlingsblüher mit ihrem süßen Nektar bieten
reichlich Kraftstoff und Energie für die erwachte Königin.
Blütensträucher, mit ihren leicht
zugänglichen Nektarien, wie z. B. Berberitze, Faulbaum und
Cotoneaster (Mispelsträucher) werden besonders gerne
angeflogen.
Aber auch verletzte, "blutende"
Bäume wie Eschen, Birken, Pappeln und Weiden sind als "Energietankstelle"
begehrt.
Die aufbrechenden Blattknospen an Obstgehölzen und ganz
besonders an Kastanienbäumen, sondern sehr zuckrig klebende,
kohlehydrathaltige Safttropfen ab, der von den
umherfliegenden Wespenköniginnen gierig, als reichhaltiger
Energiespender, aufgeleckt wird.
Als so genannte "Wespenblumen", mit
ihren, für die kurze Wespenzunge gut erreichbaren Nektarien,
gelten u. a. der Knotige Braunwurz, der Echte und
Breitblättrige Sumpfwurz, die Zwergmispel etc.
Alles in Allem spielen neben den
Bienen, Hummeln und Wildbienen, auch die Wespen keine
unwesentliche Rolle beim Bestäuben von Blütenpflanzen.
|

Hornissenkönigin an Berberitzenblüten |

Hornissenkönigin an Berberitzenblüten |

Hornissenkönigin an einer blühenden Fächermispel |

Hornissenkönigin an einer blühenden Fächermispel |

Königin der Sächsischen Wespe an
Fächermispel |

Königin der Mittleren Wespe an
Fächermispel |

Königin der Deutschen Wespe an
Zuckerlösung |

Königin der Deutschen Wespe an
Bienen-Futterteig |
|
Nistplatzsuche
und Grundsteinlegung für den zukünftigen Wespenstaat
|
|
|
|
Nach einigen Tagen Nahrungsaufnahme beginnen die Wespenköniginnen systematisch
mit der Suche nach einem geeigneten Standort, für den zukünftigen Wespenstaat. In der solitären Phase
geschieht die Nestgründung durch eine einzelne Königin.
Bei
den Feldwespen können sich
mitunter auch mehrere Königinnen an der Nestgründung beteiligen, wobei eine
Königin davon
dominiert und Eier legen darf. Die anderen Vollweibchen werden zu
Arbeiterinnen degradiert. Dennoch wechselt in der
Nestgründung immer wieder einmal die Dominanz unter den
Königinnen. Hierzu werden Hierarchiekämpfe untereinander
veranstaltet.
Für die Einen eignet sich ein verlassener Mäusebau
als zukünftiger Neststandort, die Anderen bevorzugen
einen dämmrigen Dachboden, und wieder Andere halten einen
Zweig in dichtem Gebüsch für die Nestgründung ideal. Gartenhütten,
Geräteschuppen und oftmals wird auch ein Rollladenkasten zur
Staatengründung, mit geeignetem Mikroklima, ausgesucht.
Aus verwitterten und abgenagten Holzsplittern, vermischt
mit Speichel, entsteht ein Holzbrei der als Baumaterial für
das Papiernest dient.
So formt die Königin aus dem gewonnenen Baumaterial
einen kleinen, etwa nageldicken Zapfen, an dem sie die
ersten drei Wabenzellen installiert. Noch vor Vollendung der
ersten Wabenzellen legt die Königin, in jede dieser Zellen, ein
Ei.
|

Königin der Gemeinen Wespe an einem
Dachbalken |

Königin der Deutschen Wespe an einer
Papiertüte |

Königin der Mittleren Wespe an der
Verschraubung eines Vordachs |

Hornissenkönigin an einem Dachüberstand |
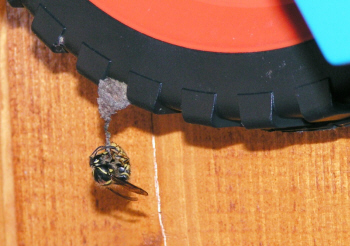
Königin der Sächsischen Wespe an einem
Streuwagenrad |

Königin der Sächsischen Wespe in einem
Holzschuppen |

Einzelne Königin der Haus-Feldwespe,
Nestgründung in einem Stahlrohr-Zaunpfahl |

Nestgründung mehrerer Königinnen der
Haus-Feldwespe,
in einer Regentonne |
|
Nachdem der Neststandort festgelegt ist
und mit der Nestgründung begonnen wurde, wartet für die
nächsten Wochen eine
wahre "Herkulesarbeit" auf die Königin.
Nur die stärksten Königinnen,
mit den besten Neststandorten, werden diese gefährliche und
arbeitsreiche Phase überstehen ...
|
Nesterweiterung
Nun ist die Königin ständig damit
beschäftigt, das Nest auszubauen und zu erweitern. Täglich
werden neue Wabenzellen angelegt und
auch gleich bestiftet.
Besonderes Augenmerk legt die Königin
auf die Errichtung der Außenhülle, die sich langsam, wie
eine Glocke über die kleine Wabe spannt. Schließlich
entsteht eine Tischtennisball kleine Kugel, mit einem winzigen
Schlupfloch an der Unterseite. In der kompletten,
solitären Phase werden etwa 4 Hüllen, vorhangartig, über die kleine
Anfangswabe gebaut. Die Nesthülle mit ihren Luftpolstern dient als Isolationsschicht.
Sie hält
die Wärme im Nest und schützt vor den wechselnden
Außentemperaturen im Frühjahr.
Die Hornissenkönigin baut eine etwa
mandarinengroße, beige/braune Nestkugel, aus einer einzigen
Nesthülle, die unten offen ist.
|

Königin der Gemeinen Wespe erweitert die
Außenhülle |

Königin der Hornisse erweitert die
Nesthülle |

Königin der Sächsischen Wespe erweitert
die Außenhülle |

Sächsische Wespe, die 3. Nesthülle wird
angefangen |
Brutpflege und "Klimaanlage"
|
 |
 |
| Etwa 3 - 6
Tage, nachdem das Ei gelegt wurde, schlüpft die Larve,
die dann kopfunter in der Zelle klebt. |
Später werden die Larven aufgrund ihrer
Körpermasse fest in den Zellen stecken. |
|
Das Frühjahr mit seinen extrem
wechselnden Wärme- und Kälteperioden verlangt der Königin
ein weiteres Maß an Arbeit ab.
Um eine gleich bleibende
Temperatur im Nest zu erhalten, sorgt die Königin für einen
Wärme- bzw. Kälteausgleich.
Als kleine "Klimaanlage"
wird an heißen Tagen Wasser ins Nest transportiert, auf der
Wabe verteilt und durch Flügelschlagen Luft zugeführt. Die
Verdunstung des Wassers kühlt das Nest.
Droht Unterkühlung bewegt die
Königin, mit ausgekugelten Flügeln, also im Leerlauf, ihre
Flugmuskulatur und erzeugt die nötige Wärme.
Dabei legt sie sich flach auf
die Wabe, ihren Körper dicht um den Wabenstiel geschlungen.
|
 |
 |
| Brüten -
Die Hornissenkönigin erzeugt Wärme mit der Flugmuskulatur |
Fütterung der Larven |
|
Die ersten Larven schlüpfen und
wollen gefüttert sein, und zwar mit Kraftnahrung aus
eiweißreichem Insektenfleisch.
Immer wieder unterbricht die Königin ihre Bauarbeiten, wenn
die hungrigen Larven mit ihren Kiefern fordernd an ihren
Zellwänden kratzen und um Futter betteln.
Nach etwa gut zwei Wochen
ausreichender Wärme
und guter Fütterung sind die ersten Larven ausgereift,
verschließen die Zellen mit einem seidenen Puppendeckel und
verspinnen sich in einem einen dichten Kokon. Unter dessen
Schutz verharren sie rund zwei Wochen als unbewegliche Puppe
.
|

Königin der Sächsischen Wespe erweitert
die Außenhülle |

Sächsische Wespe, 3. Nesthülle wird
aufgebaut |
|
Im Inneren des mumienhaften
Puppengebildes spielt sich umwälzendes ab:
Bei ausreichender Wärme vollzieht sich in gut weiteren 14 Tagen die vollkommene Verwandlung von der
Puppe zur fertigen
Wespe - zu einem Insektenweibchen, das deutlich kleiner als die
Königin ist und dessen verkümmerte Eierstöcke es zur Arbeiterin
vorbestimmen.
|
|
Selbstversorgung
|
|
Neben all diesen Arbeiten muss sich die
Königin natürlich auch selbst versorgen. So fliegt sie immer wieder ihre
bekannten Saft und
Nektarquellen an, um Energie zu tanken. Gerne wird auch die
bereit gestellte Futterquelle eine Hornissenliebhabers
angenommen.
|
 |
 |
|
Aufnahmen: Ralf Schreck © 2013 |
Gefahren
|
 |
 |
|
Kommt die Königin in der solitären
Phase ums Leben oder wird im Revierkampf und durch sonstige,
schwerwiegende Störungen vertrieben, bleibt lediglich die
kleine graue und tischtennisballgroße Nestkugel übrig, die man oft zahlreich auf
Dachböden, nicht isolierter Dächer, finden kann.
|
 |
|
In den Waben
verhungern die Larven, fallen aus den Zellen und werden
schwarz.
Sind bereits Puppen vorhanden, kommt es
unter dem weißen Puppendeckel zum Entwicklungsstillstand.
Die Puppen sterben in ihren Zellen.
|
Nestverteidigung
und Revierkampf
|
|
Besonders unter den Hornissen sorgen
Revierkämpfe und feindliche Nestübernahmen,
- Usurpation -
(lat.
usurpatio ‚Gebrauch‘;
usurpare
„in Besitz nehmen“, „widerrechtlich die Macht an sich
reißen“)),
in der solitären Phase, für Verluste
unter Hornissenköniginnen. Nicht selten gehen solche Revier-
oder Übernahmekämpfe tödlich aus.
Im
Jahr 2015 konnte Luca M., an einer Hornissengründung, in
einem Vogelkasten im Garten, insgesamt 13 Übernahmen durch
12 verschiedene Königinnen beobachten. Einmal wurde dabei
das Nest von der selben Königin wieder zurück erobert. Aber
auch sie wurde später von einer anderen Königin vertrieben.
|
|
Nestübernahmeversuch:
Aufnahmen:
Hans Bugert © 2013
|
|

... vom Stachel getroffen - sterbende
Usurpantin ... |

... die tote Usurpantin unter dem
Gründungsnest |
| |
Revierkampf
Aufnahmen: Günther
Faust © 2011
|
|
 |
 |
 |
22. April
Eine fremde Königin der Gemeinen Wespe nähert
sich dem Gründungsnest. Bei Annäherung kommt die
Nestgründerin wütend aus dem Einflugloch und
vertreibt die feindliche Wespe. |
24. April
Auch heute nähert sich wieder eine/die fremde
Königin dem Wespennest. Auch dieses Mal kann die
Nestgründerin die Fremde Wespe vertreiben. |
26. April
Das Nest steht leer. Es fliegt keine Königin
mehr das Nest an. Vermutlich fand ein
Revierkampf statt, bei dem dieses Mal die
Nestgründerin unterlegen war. |
In der solitären Phase, ist die Königin noch vielen weiteren
Gefahren
ausgesetzt:
|
|
Schlechtwetterperioden mit
längeren Regen- oder Kälteeinbrüchen
|
|
 |
|
Das Frühjahr hat wetterbedingt auch seine
Schattenseiten.
Nach einem schönen und sonnigen
Frühjahresbeginn und der erfolgreichen Nestgründung der
Wespenköniginnen, können lang anhaltende und über
mehrere Wochen andauernde Regen- oder sogar Kälte- und
Schneeperioden dem jungen Wespenstaat ordentlich zusetzen. In solchen
schlecht Wetterperioden verkriechen sich natürlich auch die
Beuteinsekten. So ist es der Königin unmöglich, ihre Larven
mit eiweißreicher Insektenbeute zu versorgen. Der junge
Staat verhungert förmlich unter solchen
Witterungsbedingungen. Das Frühjahr 2012 war z. B. solch ein
Schlechtwetterfrühjahr. Etwa zweidrittel der Nestgründungen
gingen damals verloren.
Wer allerdings dem Wetter trotzt und
es schafft durchzuhalten, der kommt später, im wahrsten
Sinne des Wortes, vom "Regen in die Traufe".
Viele Neiderinnen,
die selbst ihr Nest verloren haben, werden versuchen den überlebenden Staat zu übernehmen
und darum zu kämpfen
... |
|
Fressfeinde
|
 |
 |
|
"Auch der Jäger wird zum gejagten ..."
Neben Vögeln, die bereits Nachwuchs im
Nest haben, warten auch andere Fressfeinde darauf, einen fetten
Happen zu erbeuten.
|
|
In eine Wohnung geraten ...
|

Königin der Deutschen Wespe am
Fenster
|
|
Auf der Suche nach Beute inspiziert die
Königin gerne auch mal eine Fensterecke. Hierbei kann es
passieren, dass die Wespenkönigin über ein gekipptes Fenster
in die Wohnung gerät. Auf dem Weg zurück versucht sie nun -
vergeblich - an der Fensterscheibe nach draußen
zu gelangen. Mit dem Versuch nach draußen zu gelangen
verfliegt die Wespenkönigin ihre Energie und bleibt "unterzuckert"
auf der Fensterbank liegen, bis sie schließlich stirbt.
Oft passiert es, dass jemand auf das
Brummen der Wespe aufmerksam wird. Nicht selten wird die
Wespenkönigin dabei erschlagen.
Fazit: Der junge Wespenstaat stirbt ohne
Königin ...
Dabei wäre es doch so einfach, das
Fenster zu öffnen und die Königin nach draußen zu befördern.
Eine andere Möglichkeit wäre z. B. ein Glas über die Wespe
zu stülpen und mit einem Blatt Papier abzudichten. Die
gefangene Königin kann nun einfach am geöffneten Fenster
frei gelassen werden.
|
|
Insektizide / Vergiftete Beute
|

|
|
Gartenarbeiten - besonders im Frühjahr
werden Obstgehölze und Pflanzen gegen Schädlingsbefall
gespritzt.
Unachtsam ausgebrachte Spritzmittel,
besonders diejenigen, die als "bienengefährlich"
gelten, machen nicht nur den Blütenbesuchern das Leben
schwer.
Bereits kontaminierte Insekten, die sich
im Sterben brummend und kreiselnd auf dem Boden bewegen,
werden als leichte Beute von Wespen, Vögeln und Ameisen
erkannt und gefressen oder an die Brut verfüttert. Was solch
verfütterte, mit Gift kontaminierte Insekten anrichten, kann
sich jeder selbst ausmalen ...
|
|
Straßenverkehr
|
|

|
|
Auch das ist eine Option, wenn die
Wespenkönigin plötzlich nicht mehr zum Nest zurück kehrt:
Im Straßenverkehr, gegen eine
Windschutzscheibe geflogen, das endet meist tödlich für
viele, viele Insekten. |
|
Statistik:
von den 20 - 40 verbliebenen
Königinnen, die aus der Winterruhe erwacht sind, werden
wiederum etwa 90% die solitäre Phase - vom Erwachen bis zum Schlupf der ersten
Arbeiterinnen -, die etwa 6 - 8 Wochen andauert, nicht
überleben.
Revierkämpfe, Kälteeinbrüche,
Schlechtwetterperioden, Fressfeinde und nicht zuletzt der
Mensch, werden mancher Königin ordentlich zusetzen, sie töten oder
vertreiben und so die Nestgründung vorzeitig stoppen.
So schrumpft die Anzahl der Königinnen auf
2 - 4 Königinnen.
|
... und dann endlich, gut 4 Wochen nach der
Nestgründung ist es soweit - die erste Arbeiterin öffnet den
Puppendeckel und verlässt ihre Wabenzelle ...
|
Gut 6 - 8 Wochen nach dem Beginn der
Solitären Phase
schlüpft die erste Arbeiterin. |
nun beginnt die
|
Kooperative
Phase
Schlupf der ersten Arbeiterinnen,
Revierkampf, Nestverteidigung gegen Übernahme
Königin fliegt nun immer weniger aus |
|























